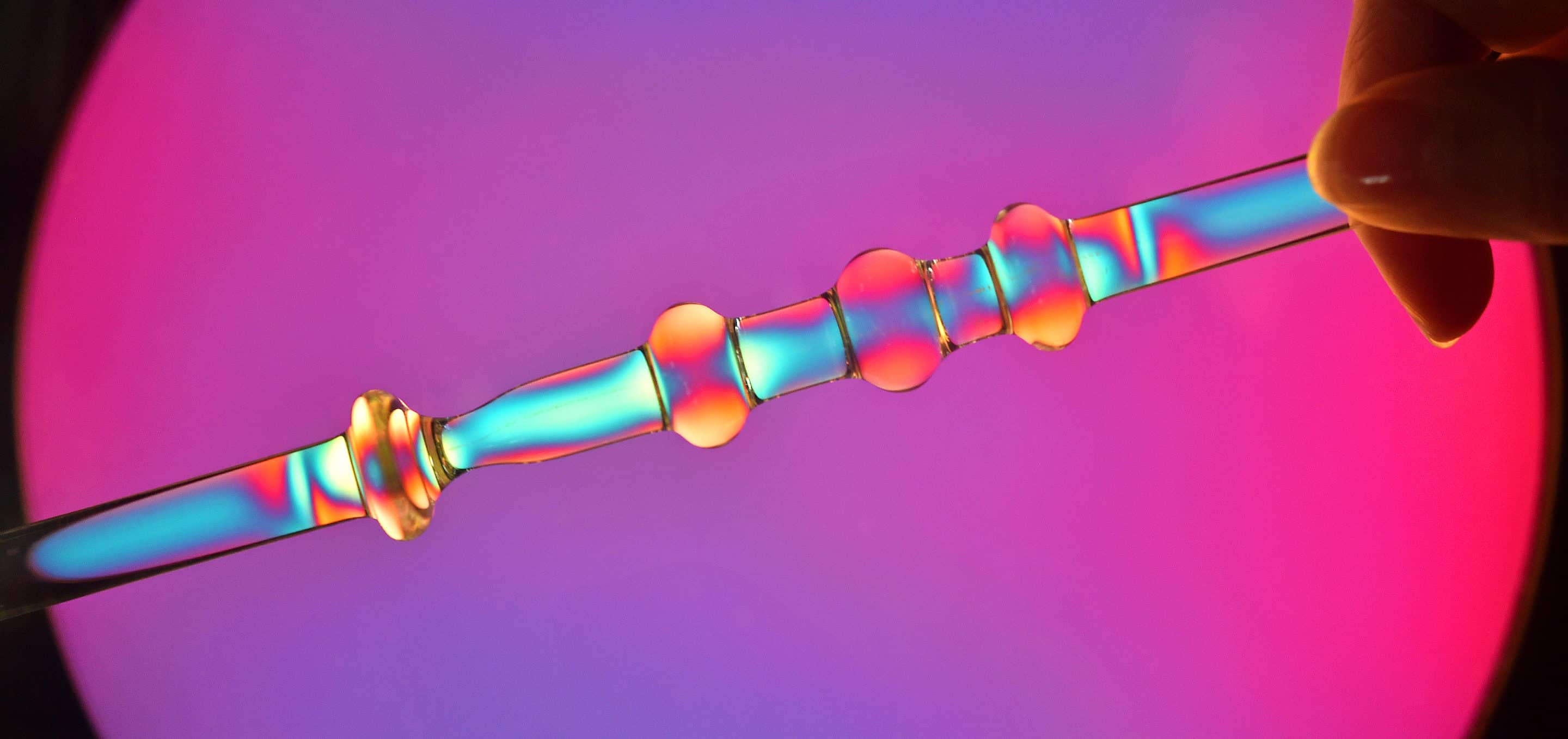Über 30.000 Studierende der renommierten Georg-August-Universität, der Hochschulen und Forschungseinrichtungen prägen nicht nur das Stadtbild, sondern auch das Lebensgefühl der Stadt. In keiner Großstadt in Deutschland machen die Studierenden einen größeren Anteil an der Einwohnerzahl aus. Isaac Newton sagte einst: „Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ist ein Ozean“. Es gibt also noch viel zu tun. Doch wo wird in Göttingen eigentlich Wissen geschaffen? Eine Auswahl.
Die Georg-August-Universität
Zum Wohle aller
Im Jahr 1734 gegründet, kann die Georg-August-Universität eine imposante Historie vorweisen. Wissenschaftlicher Pragmatismus, Realitätssinn und Bewusstsein für die gesellschaftliche Verantwortung der Wissenschaft prägen die Geschichte der Universität bis in die Gegenwart. Dementsprechend lautet ihr Leitbild: „In publica commoda – Zum Wohle aller. Die Georg-August-Universität ist keine klassische Campus-Universität, sondern verteilt sich, historisch bedingt, bis in die Gegenwart über eine Vielzahl von Gebäuden in der ganzen Stadt.

30.000 Studierende an Uni, Hochschulen und Forschungseinrichtungen: Mittagszeit auf dem Campus am Platz der Göttinger Sieben.
Foto: Christoph Mischke
13 Fakultäten, über 500 Professor*innen
Mit ihren 13 Fakultäten in den Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften sowie der Medizin ist sie breitgefächert aufgestellt. Über 500 Professor*innen und mehr als 4.000 wissenschaftliche Mitarbeiter*innen sind in Forschung und Lehre tätig. Eine wichtige Komponente im Zukunftskonzept ist der Göttingen Campus, eine Vernetzung von Uni und Universitätsmedizin mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Göttingen. Dazu gehören die Akademie der Wissenschaften, das Deutsche Primatenzentrum, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie vier Max-Planck-Institute (MPI).
Viermal MPI in Göttingen
Nervenimpulse und disziplinäre Vielfalt
Die Namen der vier Göttinger Max-Planck-Institute klingen mitunter etwas sperrig, ihre Grundlagenforschung ist aber essentiell. Das MPI für Dynamik und Selbstorganisation erforscht grundlegende Mechanismen des Zusammenwirkens, um ein detailliertes Verständnis komplexer Systeme zu erlangen. Beispiel: So genau man auch einen Nervenimpuls vermessen kann, so versteht man noch nicht, wie Milliarden von ihnen einen Gedanken formen.

Es geht um unsere kosmische Heimat: das MPI für Sonnensystemforschung.
Foto: Christoph Mischke
Wissen am Fassberg: das MPI für Dynamik und Selbstorganisation.
Foto: Christoph Mischke
IT: ohne Rechenleistung keine Forschung.
Foto: Christoph Mischke
Die Göttinger Max-Planck-Institute für biophysikalische Chemie und für experimentelle Medizin haben zum 1. Januar 2022 fusioniert. Es entstand das neue MPI für multidisziplinäre Naturwissenschaften. Es deckt ein deutlich breiteres Forschungsspektrum ab und fördert die disziplinäre Vielfalt. Mit insgesamt 16 Abteilungen und über 25 Forschungsgruppen ist das neue MPI das größte Institut in der Max-Planck-Gesellschaft.
Kosmische Heimat und kulturelle Anpassung
Im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Arbeiten am MPI für Sonnensystemforschung steht unsere direkte kosmische Heimat: das Sonnensystem mit seinen Planeten und Monden, mit seinen Kometen und Asteroiden und natürlich der Sonne. Um diese Körper zu untersuchen, entwickeln und bauen die Forscher*innen zusammen mit Ingenieur*innen und Techniker*innen wissenschaftliche Instrumente, die vor allem im Weltraum eingesetzt werden. Zu diesem Zweck ist das Institut an zahlreichen Missionen internationaler Weltraumagenturen wie etwa der ESA und der NASA beteiligt.
Das MPI zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften bleibt mit den Füßen fest am Boden. Es ist eines der führenden Zentren für die multidisziplinäre Erforschung der vielfältigen Formen von gesellschaftlicher Vielfalt in der heutigen globalisierten Welt. Man erforscht beispielsweise Fragen nach dem Verhältnis zwischen Mobilität und Ungleichheit, dem Zusammenspiel von Globalisierung, religiöser Vielfalt und dem weltlichen Staat oder den rechtlichen Grenzen von kultureller Anpassung.
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Zwischen Vakuumkammer und Windkanal
Göttingen gilt als die Wiege der modernen Aerodynamik. Hier wurde 1907 die weltweit erste staatliche Luftfahrtforschungseinrichtung gegründet. Seitdem werden hier wichtige Grundlagen der modernen Luftfahrt erforscht.

236 Kubikmeter Weltraum: die Vakuumkammer im DLR.
Foto: Christoph Mischke
Heute arbeiten im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Göttingen gut 480 Fachleute an den Flugzeugen, Raumschiffen und Hochgeschwindigkeitszügen der Zukunft. Das DLR besitzt sogar ein eigenes Großraumflugzeug, obwohl es in der Stadt schon lange keinen Flughafen mehr gibt. Es dient der Erforschung eines besseren Klimas an Bord von Flugzeugen und der Corona-Forschung.
Realistische Simulation
Die Vakuumkammer ist eine Versuchsanlage, in der 236 Kubikmeter Weltraum mitten in Göttingen erzeugt werden. Hier werden bei minus 268 Grad Celsius Ionentriebwerke für Raumfahrzeuge getestet. In der Tunnelsimulationsanlage können Zugmodelle bis auf Tempo 360 beschleunigt werden. Wie Flügelprofile zukünftige Transportflugzeuge widerstandsärmer und effizienter gestaltet werden können, wird im Kryo-Rohrwindkanal erforscht. Als einer von zwei Windkanälen in Europa, kann er die realistische Simulation der benötigten Flugbedingungen abbilden.
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst
Rund 1.800 HAWK-Studierende
Göttingen ist, neben Hildesheim und Holzminden, einer von drei Standorten der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK). Hier ist sie mit den Fakultäten Ressourcenmanagement, Ingenieurwissenschaften und Gesundheit mit dem Gesundheitscampus Göttingen vertreten.

Ingenieurwissenschaften: Gebäude der HAWK Göttingen auf den Zietenterrassen.
Foto: HAWK
Rund 1.800 HAWK-Studierende arbeiten in kleinen Lerngruppen und Praxisprojekten. In den acht Studiengängen des Ressourcenmanagements geht es unter anderem um urbanes Waldmanagement, Wirtschaftsingenieurwesen mit Fokus auf ressourcenschonende Energietechnik und Produktion oder Stadt- und Regionalentwicklung sowie erneuerbare Energien.
Qualifikation neu gedacht
An der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Gesundheit werden Themen der Zukunft behandelt, wie etwa Softwareentwicklung, Informatik, Laser- und Plasmatechnik, regenerative Energien oder Medizintechnik. Der Gesundheitscampus wurde gegründet, um die Qualifikation in den Gesundheitsberufen neu zu denken. Künftige Fachkräfte werden in diesen Bereichen auf die gesundheitlichen Versorgungsbedarfe der Zukunft vorbereitet. Dabei geht es vor allem um erweiterte Kenntnisse und die Fähigkeit, mit anderen Berufsgruppen interdisziplinär zusammen zu arbeiten.
Südniedersachsen-Innovations-Campus
Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft
Die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft hat sich der SNIC auf die Fahne geschrieben. SNIC steht für Südniedersachsen-Innovations-Campus. Er schlägt eine Brücke zwischen Hochschulen und Unternehmen und vernetzt sie mit Kommunen und Kammern.

Vernetzung: Der Pre-Inkubator des SNIC steht Studierenden, Absolventen und Mitarbeitern der regionalen Hochschulen offen.
Foto: Christoph Mischke
So sollen Unternehmen intensiver von den Forschungsergebnissen profitieren und der Zugang zu Fachkräften erleichtert werden. Durch gezieltes Scouting und diverse Veranstaltungen werden wissenschaftliche Kompetenzen an den Hochschulen kleinen und mittleren Unternehmen in Kooperationsprojekten zugänglich gemacht. Die anwendungsorientierten Angebote für Studierende machen regionalen Unternehmen weiteres wissenschaftliches Know-how zugänglich.
PFH Private Hochschule Göttingen
Konsequente Praxisorientierung
1995 wurde die PFH Private Hochschule Göttingen gegründet. Seitdem wurde sie vom Niedersächsischen Wissenschaftsministerium anerkannt und ist somit die älteste private, staatlich anerkannte Hochschule Niedersachsens.

Wissen vermitteln: Studierende im Hörsaal der PFH Göttingen.
Foto: Christoph Mischke
Anstoß zu ihrer Gründung war der Gedanke, mit einer rein privatwirtschaftlich finanzierten Hochschule neue Impulse im Bereich Wissenschaft und Lehre zu setzen und ein Studienangebot an den realen Bedürfnissen der Wirtschaft zu orientieren. Konsequente Praxisorientierung und ausgeprägte Internationalität gehören zu ihrem Leitbild. Die PFH Göttingen bietet Studienprogramme aus den Bereich BWL, Psychologie, Informatik, Healthcare Technology, UX Design und Recht an.
XLAB
Experimentallabor für junge Leute
Das XLAB ist eines der größten Schülerlabore Deutschlands für die MINT-Fächer Physik, Chemie, Biologie und Informatik.

Farbklecks im Uni-Nordbereich: XLAB, eines der größten Schülerlabore Deutschlands.
Foto: Christoph Mischke
Der vielfach ausgezeichnete außerschulische Lernort bietet unter anderem Schülergruppen im Rahmen ihres Unterrichts spannende „Hands-on“-Experimentalkurse. Schüler*innen, die mehr wissen wollen, erhalten umfangreiche Angebote und Fortbildungen für Lehrkräfte zu aktuellen Wissenschaftsthemen. Kurzum: Das XLAB beweist, dass Naturwissenschaft durch Experimente gar nicht trocken sein muss, sondern richtig Spaß machen kann.
YLAB
Animierende Lernumgebung
„Vorsicht, Geistesblitze“, heißt es beim YLAB, dem geisteswissenschaftlichen Schülerlabor der Universität Göttingen.

“Tag der Erinnerung”: Göttinger Schüler*innen erkunden Orte der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Foto: Christoph Mischke
Hier haben die Schüler*innen die Möglichkeit, sich in animierender Lernumgebung, inklusive einer Bühne, bunter Sitzkissen und Theaterrequisiten, aktiv und experimentell mit Themen der Geisteswissenschaften auseinander zu setzen. Auch für Lehramtsstudierende ist das YLAB von Interesse. Als Lehr-Lern-Labor für die Fächer Englisch, Französisch, Latein, Deutsch, Geschichte und Religion bietet es Gelegenheit, gemeinsam mit Dozierenden handlungsorientierte Unterrichtsszenarien zu entwickeln. Diese können mit Schülergruppen ausprobiert werden und dadurch über die erforderlichen Schulpraktika hinaus weitere Praxiserfahrungen zu sammeln.
Deutsches Primatenzentrum
Zucht, Haltung und Einsatz
Das Deutsche Primatenzentrum (DPZ) im Leibniz-Institut für Primatenforschung betreibt biologische und biomedizinische Forschung auf allen Gebieten, in denen Studien an nichtmenschlichen Primaten eine zentrale Rolle spielen.

Deutsches Primatenzentrum: Eva Gruber-Dujardin, Fachärztin für Pathologie, am Konfokalmikroskop.
Foto: DPZ / Karin Tilch
Das gilt vor allem für die Infektionsforschung, die Neurowissenschaften und die organismische Primatenbiologie. Mit seinen Kompetenzen und seiner Infrastruktur setzt das DPZ nach eigenen Angaben Maßstäbe für Zucht, Haltung und experimentellen Einsatz von Primaten. Das DPZ berät und unterstützt andere Forschungseinrichtungen, unter anderem durch die Bereitstellung von Tieren aus seiner Zucht. Außerdem unterhält das DPZ vier Feldstationen, um Primaten in ihren Herkunftsländern zu erforschen.